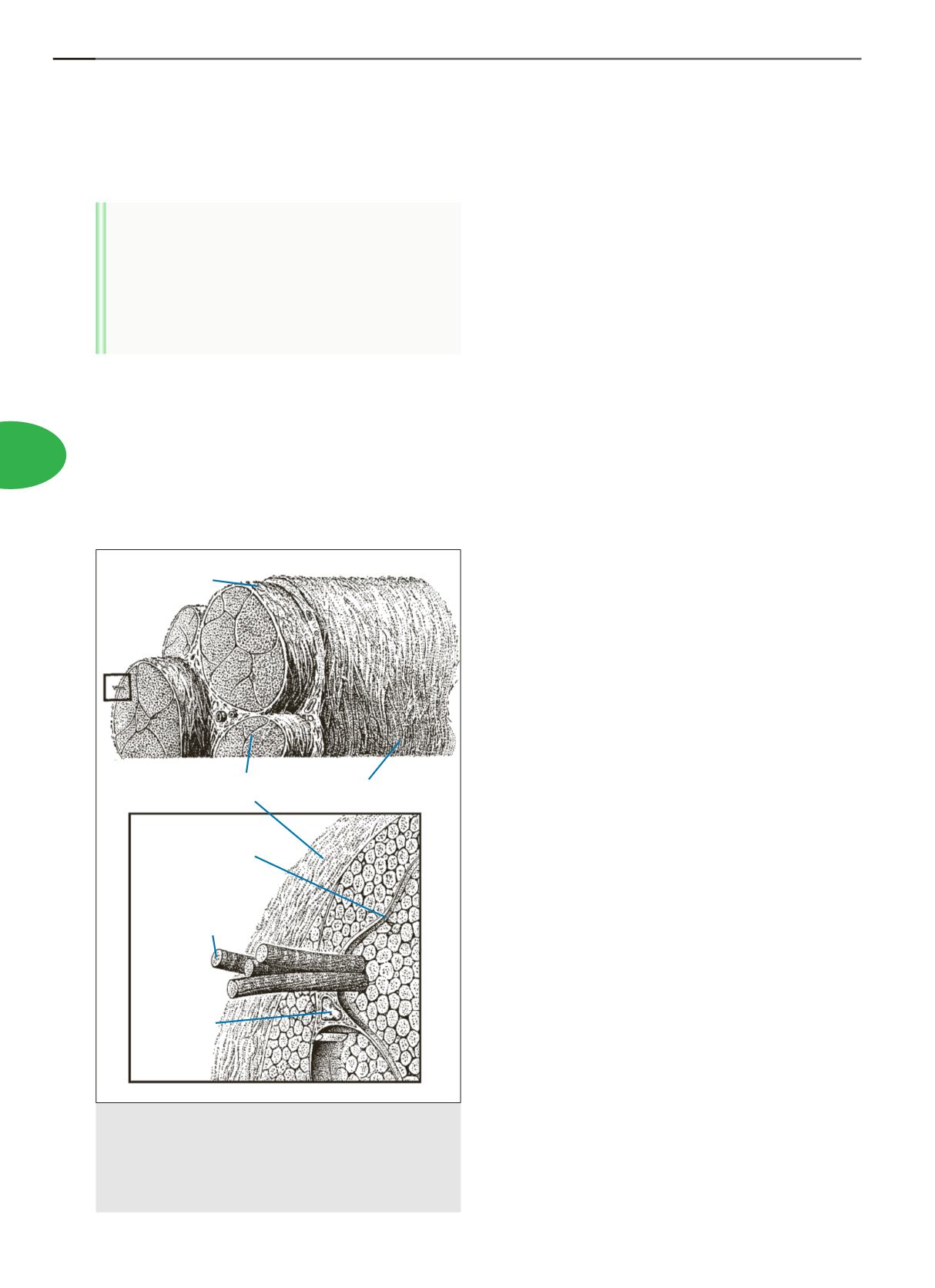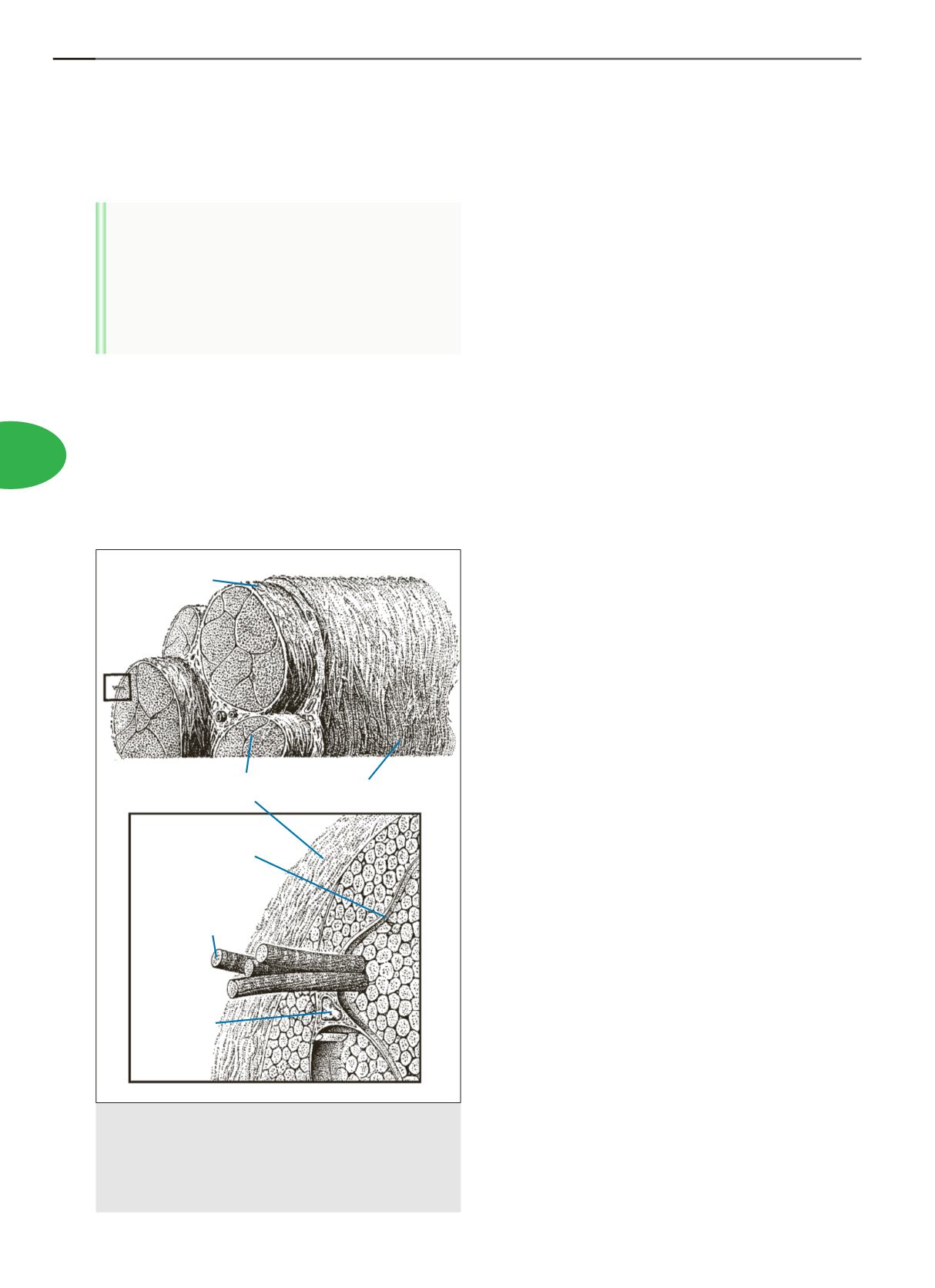
68
Muskellehre
(Myologie)
6
sie wie die Augenmuskeln nur ein geringes Gewicht zu
bewegen haben (
▶
Kap. 6.6).
6.5 Hilfseinrichtungen des Muskels
Jeder Skelettmuskel steht mit besonderen „Hilfs-
einrichtungen“ in näherer oder entfernterer Art in
einem funktionellen Zusammenhang:
•
die Sehnen (mit Sehnenscheiden und Sesambei-
nen), Muskelbinden und Schleimbeutel,
•
die motorischen und sensiblen Nerven und die
Blutgefäße.
6.5.1 Sehnen, Muskelbinden und
Schleimbeutel
Sehnen
Die im Querschnitt runden bis ovalen Sehnen beste-
hen aus weitgehend unelastischen, kollagenen Binde-
gewebsfasern, in denen Nerven und sensible Endorgane
(sog. „Sehnenspindeln“, auch als „Golgi-Sehnenspindel“
bezeichnet) angetroffen werden (s. o.). Wenn somit rein
gewebsmäßig die Sehnen dem Muskelfleisch recht
fremd gegenüberstehen, so bilden sie dennoch mit die-
sem eine funktionelle Einheit (s. u.). Die Sehnen stellen
ein elastizitätsarmes Gewebe dar. Strukturell sind sie
aus Sehnenfasern und diese wiederum aus zahlreichen
Sehnenfibrillen (Abb. 6.16) aufgebaut. Die Sehnenober-
fläche wird von einem lockeren, Blutgefäße und Nerven
führenden Bindegewebe
(Paratendineum)
umhüllt, aus
dem das festere
Peritendineum externum
hervorgeht. Die
Sehnenfibrillen sind umhüllt von einem
Peritendineum
internum
und einem
Endotendineum.
Das Sehnengewebe lässt sich bei
Dehnung
höchstens bis
zu 4% seiner Länge verlängern, wobei zu berücksichtigen
ist, dass die primären Sehnenbündel inMuskelruhe einen
welligen Verlauf, bei Muskelkontraktion dagegen einen
glatten erkennen lassen (da der wellige Verlauf bei der
mit der Muskelverkürzung verbundenen Dehnung der
Sehne ausgeglichen wird). Damit wird ein ruckartiger Be-
ginn der Bewegung verhütet; sie wird „weich eingeleitet“
(
▶ Kap.
3.2.4). Die parallel zu den kollagenen Fasern
verlaufenden elastischen Fasern bedingen – wenn auf die
Sehne kein Zug ausgeübt wird – eine geringe Retraktion
der Sehnenlänge (um 3–5%, = „Pseudoelastizität“).
Elektronenmikroskopische Untersuchungen über die
Verbindung des Skelettmuskel- mit dem Sehnengewebe
haben den Nachweis erbringen können, dass
zwischen
Myo- undTendofibrillen keine Kontinuität
besteht. So
konnte u. a. Schwarzacher zeigen, dass die abgerundeten,
schrägen oder stufenförmigen Enden der Kraft erzeu-
genden Myofibrillen von einer doppelschichtigen (30–
70 nm dicken) Oberflächenmembran eingehüllt werden.
Die kollagenen, Kraft übertragenden Sehnenfibrillen
ziehen in 0,1–0,2 μm weite Zwischenräume zwischen
2 μm langen und bis 1 μm dicken fingerförmigen
Ausstülpungen des Sarkolemms ein, so dass eine Art
„Verzahnung“ der kollagenen Fibrillen der Sehne entsteht
(Abb. 6.17). Trotz der starken Annäherung beider Ge-
websarten konnte elektronenmikroskopisch keine Kon-
tinuität zwischen diesen festgestellt werden! Auch histo-
chemisch (durch den Nachweis von Cholinesterase an
den unregelmäßig tief zerklüfteten Muskelfaserenden)
konnte von Schwarzacher das Bestehen einer Oberflä-
chenmembran als Abschluss der Muskelfasern gegen das
Bindegewebe bestätigt werden. Der praktische Nutzen
der beschriebenen sarkolemmalen Einfaltungen (s. o.)
darf in einer beträchtlichen Oberflächenvergrößerung
des Muskel-Sehnen-Übergangs gesehen werden, über
den die Kraft übertragen wird, wobei es gleichzeitig zu ei-
ner Homogenisierung der Kraftverteilung sowie zu einer
Reduzierung der lokalen Spannung kommt (Abb. 6.17).
Das Sehnengewebe lässt wie alle anderen Gewebsarten –
wenn auch zeitlich versetzt – eine Anpassungsfähigkeit an
veränderte funktionelle Belastungen erkennen (
▶
Kap.
3.2.4), die vor allem in den ersten Entwicklungsperioden
Abb. 6.16
Feinstruktur der Sehne. Oben: Sehne und Sehnen-
fibrillen mit ihren Umhüllungen: Paratendineum, Peritendineum
externum, Peritendineum internum und Fibrillenausschnitt.
Unten: Sehnenfaser mit Sehnenfibrillen und mit einem im Quer-
schnitt getroffenen Fibrozyten.
D
E
3HULWHQGLQHXP
LQWHUQXP
3HULWHQGLQHXP
H[WHUQXP
3DUDWHQGLQHXP
)LEUR]\W
6HKQHQILEULOOH
(QGRWHQGLQHXP