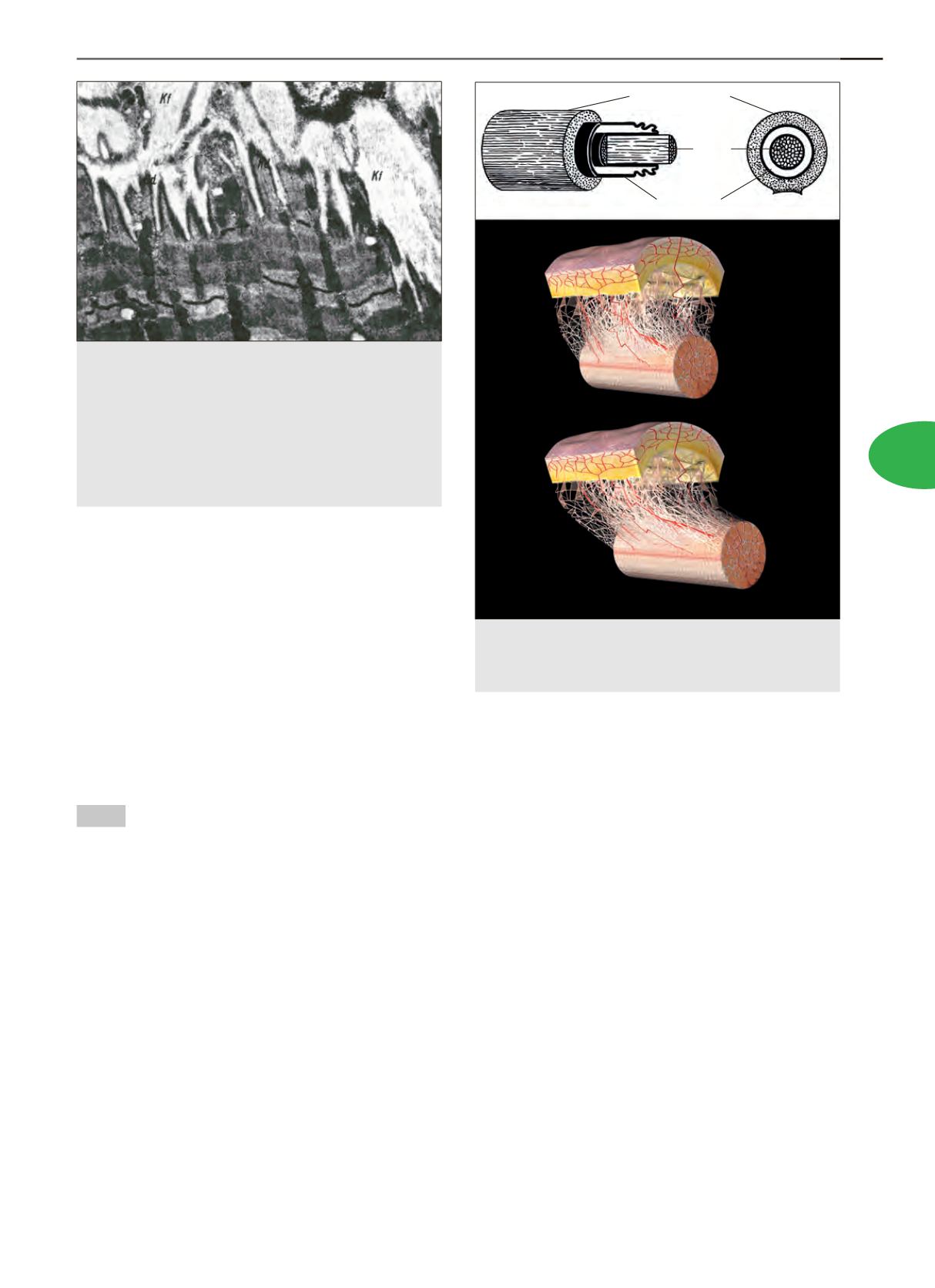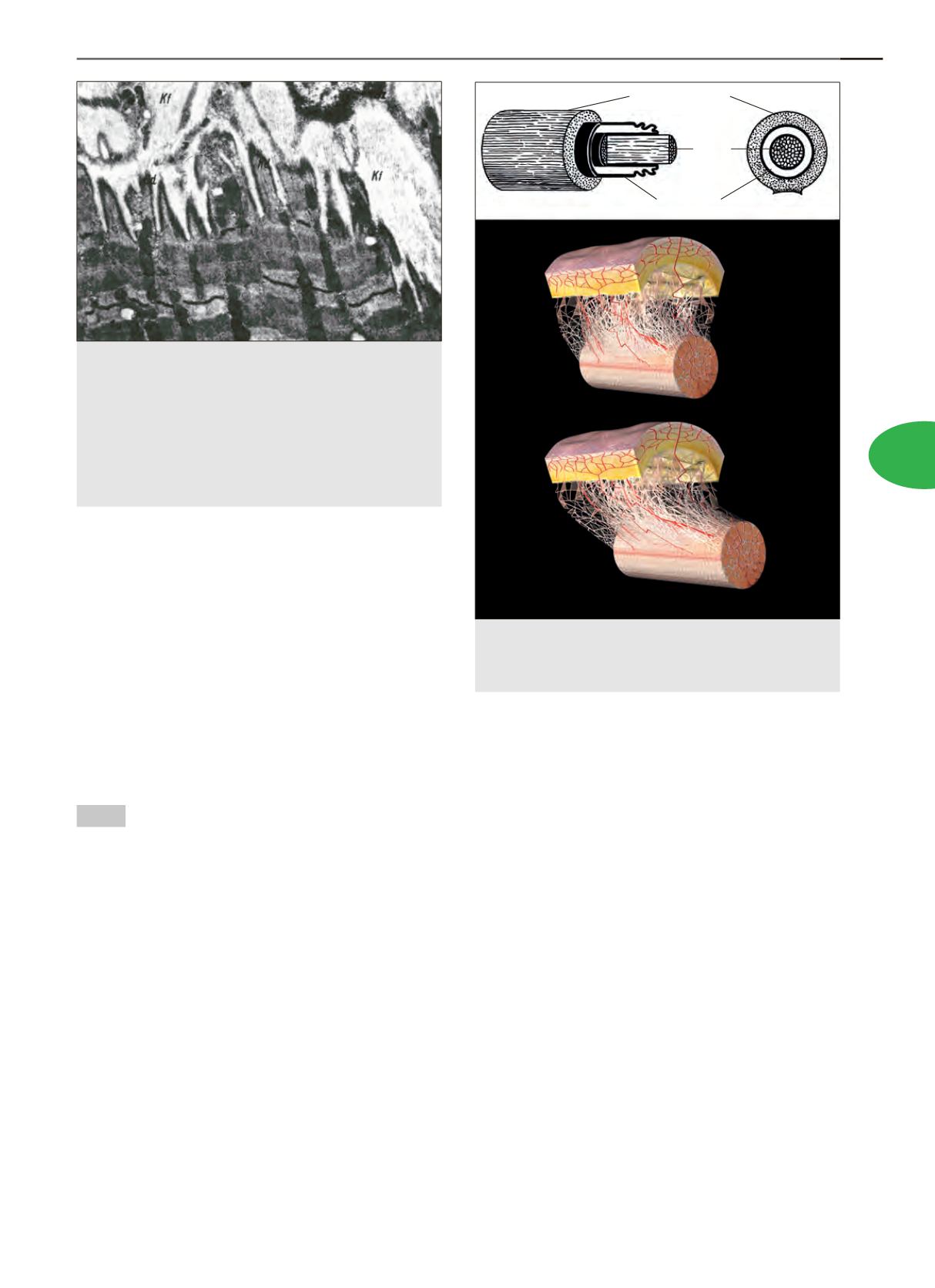
6.5 Hilfseinrichtungen des Muskels
69
6
ausgeprägt ist. In den jungen Sehnen sind demzufolge
die Bedingungen zu einer Faserhypertrophie besonders
günstig, während das Sehnengewebe insbesondere bei
gealterten Personen sich damit zufriedengeben muss,
bei Mehrbelastungen mit dem zur Verfügung stehen-
denMaterial auszukommen. Dabei verlaufen die Anpas-
sungsvorgänge im submikroskopischen Bereich,
„... das vorhandene Material wird in seiner inneren
Struktur gewissermaßen vergütet, so wie man zur
Erzielung einer größeren Zugfestigkeit ein Hanfseil
durch ein gleich dickes Perlonseil ersetzen kann.“
(Rollhäuser 1954).
K
linik
Die Sehnenquerschnittsfläche bleibt bis zum6. Lebensjahr-
zehnt annähernd konstant, die Fibrozytenzahl pro mm
3
sowie ihre Grö-
ße nehmen jedoch kontinuierlich ab, was einen Verlust an Zugfestigkeit
bedeutet, die v. a. nach längerer Ruhigstellung (Immobilisation) sich
rasch reduziert. Letztere führt bereits nach einer 20-tägigen Bettruhe
zu einer deutlichen Abnahme der Sehnenfestigkeit (Stiffness).
Sehnenscheiden und Sesambeine
Sind die Sehnen besonders lang und verschieben sich –
wie z. B. imBereich der Finger – recht beträchtlich, dann
werden sie von langen Gleithüllen, den
Sehnenscheiden
(Vagina synovialis tendinum),
völlig umhüllt. An deren
Wandungen unterscheidet man eine äußere derbe, binde-
gewebige Schicht von einer lockeren Bindegewebsschicht
innen (Abb. 6.18). Diese überzieht die Oberfläche der
Sehne, so dass man – zumal beide Schichten durch ein die
Blut- und Lymphgefäße zur Sehne führendes
Mesotenon
in Verbindung stehen – von der Sehnenscheide als einem
röhrenförmigen, geschlossenen synovialen sackförmigen
Gebilde sprechen kann. In diesem gleitet die Sehne, die
von Seiten der nicht zusammendrückbaren, schleimigen
Substanz, an deren Bildung die Hyaluronsäure wiede-
rum den Hauptanteil hat, polsterartig geschützt wird,
reibungslos.
In die äußere, derbe Schicht der Sehnenscheiden und
Gelenkkapseln sind hin und wieder – vor allem im
Bereich der Hand und des Fußes – kleine, zumeist
hanfkorngroße Knöchelchen, sog.
Sesambeine
(Ossa
sesamoidea),
eingelagert. Durch sie erhöht sich, wie es
vor allem am größten Sesambein – der Kniescheibe
(
▶
Kap. 12.2) – anschaulich beobachtet werden kann,
der Krafthebel des jeweiligen Muskels.
Muskelbinden
(Faszien)
Sie stellen einmal
Schutz gewährende Hüllen
für den
einzelnen Muskel sowie für Muskelgruppen dar und
dienen darüber hinaus dem aktiven Bewegungsapparat
als
Ursprungs- und Ansatzstellen.
Nicht zu Unrecht
kann deshalb von einem das knöcherne Skelett vervoll-
ständigenden „fibrösen
Skelett“ gesprochen warden,
das mit ersterem weitgehend in Kontakt steht, zumal
die Muskelbinden sich – wenn auch in unterschiedli-
cher Stärke – über den gesamten Körper erstrecken
(Abb. 6.19). Ihre Fasern überkreuzen sich scherengit-
terförmig, um sich den Formveränderungen des Muskels
bei Kontraktion anpassen zu können.
Abb. 6.17
Elektronenmikroskopische Darstellung der außeror-
dentlich starken Muskel-Sehnen-Verzahnung (Zwerchfell, Rat-
te). Die Myofibrillen enden in den fingerartigen Verzweigungen
der Muskelfaser an halbierten Haftstrukturen (sog. Halbdesmo-
somen [Hd]), während die kollagenen Fibrillen (Kf) am äußeren
Sarkolemm ansetzen sowie zwischen die Vorstülpungen des
Muskelfaserendes eindringen. Im Sehnenteil liegen zwischen
den Fibrillen Bindegewebszellen (Bz) mit schmalen Fortsätzen.
Abb. 6.18
Sehnenscheide. Oben: schematische Darstellung;
unten: Darstellung mittels Software „Lightwaves“ (Guimberteau,
1999).
IDVHULJHU IHVWHU 7HLO
6HKQH
ORFNHUHV %LQGHJHZHEH