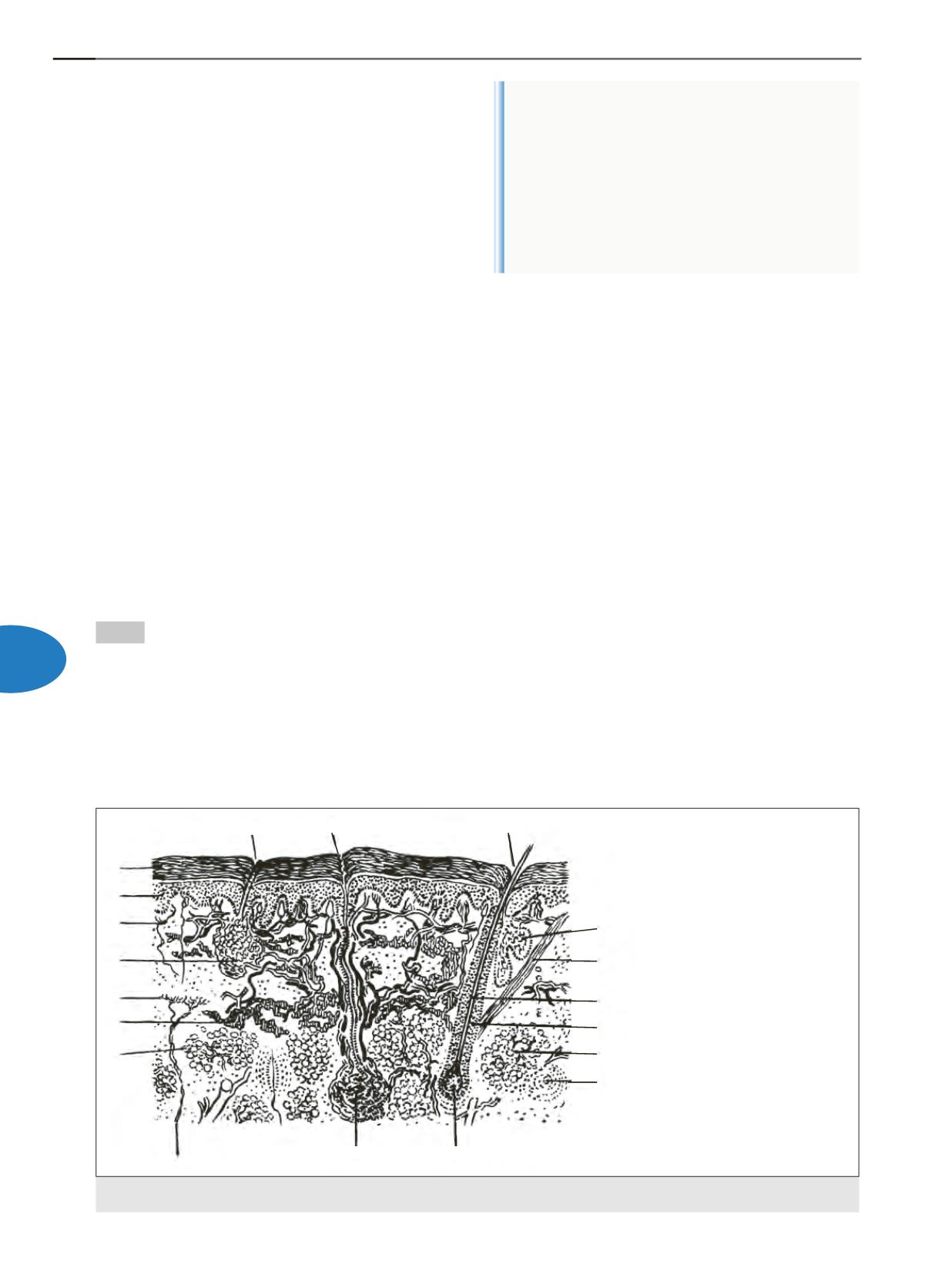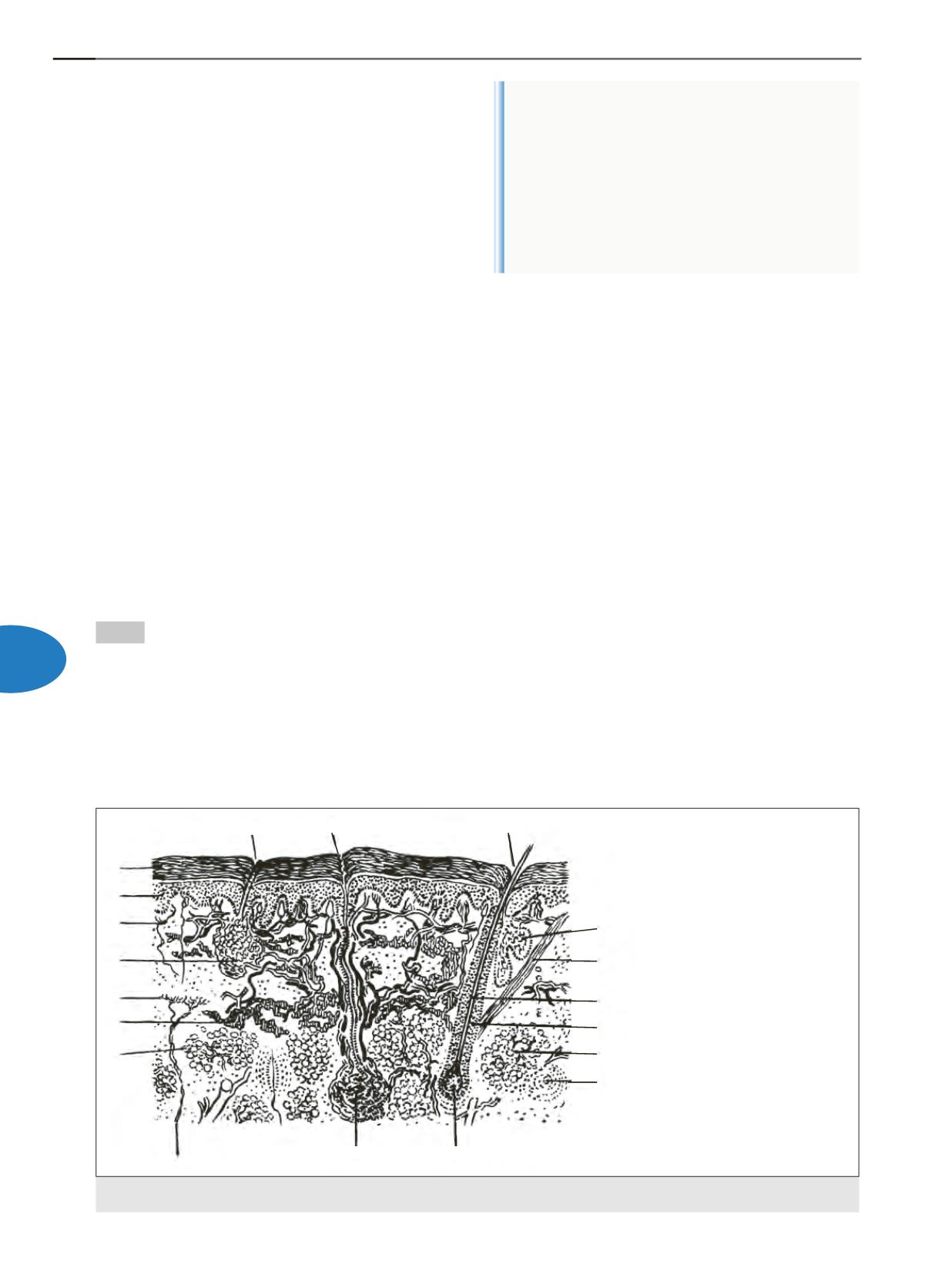
422
Die Sinnesorgane
(Organa sensuum)
23
Stoß, Schutz vor Überwärmung (Austrocknung),
Unterkühlung und Eindringen von schädigenden
Keimen
•• Bildung von Substanzen gegen Krankheiten: z. B.
Umwandlung des Ergosterins (Provitamin D
2
) der
Haut durch ultraviolette Strahlen in Vitamin D
•• Temperaturregulation durch Verengung oder Erwei-
terung der Hautblutgefäße und durch die Schweiß-
drüsen
•• Träger von unzählig vielen kleinen Tastorganen für
Druck-, Berührungs-, Kälte-, Wärme- und Schmerz-
empfindungen.
Welch fein differenziertes lebenswichtiges Gebilde ist
die Haut! Kommen doch auf 1 cm
2
durchschnittlich:
•• 2 Registrierapparate für Wärme- und 13 gleiche Ein-
richtungen für Kälteempfindungen
•• 3 Millionen Zellen,
•• 10 Haare,
•• 15 Talgdrüsen,
•• 100 Schweißdrüsen,
•• 3000 Fühlzellen an den Enden der Nervenfasern,
•• 25 Druckapparate für die Wahrnehmung von Tast-
reizen,
•• 200 Schmerzspitzen,
•• 1 m Blutgefäßschlingen und
•• 4 m Nervenfäserchen.
S
port
Auf die volle Funktionsfähigkeit der Hautrezeptoren hat
die Außentemperatur erheblich Einfluss. Bei Temperaturen um 5 °C
reagieren die Druck- und Tastrezeptoren nicht mehr auf einen Reiz, bei
20 °C nur mit 15% ihrer normalen Empfindsamkeit (Rückschlüsse auf
das „Aufwärmen“ vor Training und Wettkampf!).
Die Haut des Menschen hat eine Ausdehnung von
1,6–2,0 m
2
(Abb. 23.1) und ist an den einzelnen
Körperpartien von unterschiedlicher Dicke: sehr
dick am Rücken, sehr dünn am Augenlid. Von
außen nach innen werden drei größere Schichten
unterschieden:
•
Oberhaut
(Epidermis),
•
Lederhaut
(Dermis oder Corium)
und
•
Unterhaut
(Tela
subcutanea
, kurz: „
Subkutis“)
.
23.2.1 Oberhaut
(Epidermis)
Die blutgefäßlose Oberhaut
(
Epidermis; epi
= auf,
dérma
= die Haut) besteht im Wesentlichen aus drei Lagen:
•• einer Hornschicht, die aus keratinhaltigen Hornzellen
(Keratinozyten) aufgebaut ist,
•• einer hellen und einer verhornenden Körnerschicht
sowie
•• einer Keimschicht (Basal- und Stachelzellschicht).
Die an der Körperoberfläche gelegene
Hornschicht
(Stratum corneum)
weist ein mehrschichtig verhorntes
Plattenepithel
mit intensiv basophilen Körnchen (
Ke-
ratohyalin-Granula
als Vorläufer der eigentlichen Horn-
substanz) auf, aus dem ständig unter Steuerung des in
der Hornschicht enthaltenen Mitoseinhibitors
Chalon
(der dafür sorgt, dass basal so viele neue Zellen gebildet
werden, wie oberflächlich zugrunde gehen) abgestor-
bene, kernlose, verhornte „Zellmumien“ in Form von
Hornschuppen abschilfern (z. B. beim Abtrocknen der
nassen Körperoberfläche). Die Dicke der Hornschicht
richtet sich nach der mechanischen Belastung (besonders
kräftig z. B. im Bereich der Hohlhand und Fußsohle mit
Schwielenbildung bei Dauerdruckbelastung, besonders
dünn in Ellenbeuge, Leistenbeuge und Kniekehle).
Abb. 23.1
Schnitt durch die Haut (Schema).
1 Hornschicht der Oberhaut
(Stratum corneum)
2 Keimschicht der Oberhaut
(Stratum germinativum)
3 Meissner-Tastkörperchen
4 Teil des kutanen Gefäßnetzes
5 Lymphgefäße
6 Fettzellen
7 Talgdrüse
(GI. sebacea)
8 Haarbalgmuskel
(M. arrector pili)
9 Haar
(Pilus)
10 Haarwurzelscheide
(Folliculus pili)
11 Fett-Trauben
12 Lamellenkörperchen in der Unterhaut
(Vater-Pacini-Körperchen)
13 Haarpapille
(Papilla pili)
14 Schweißdrüsenknäuel
(GI. sudorifera)
15 Ausführungsgang einer Haarbalgdrüse
16 Ausführungsgang einer Schweißdrüse
17 Ausführungsgang einer Talgdrüse
18 Haarbalgdrüse
18
8
9
10
11
12
6
5
4
3
2
1
7
13
14
17
16
15