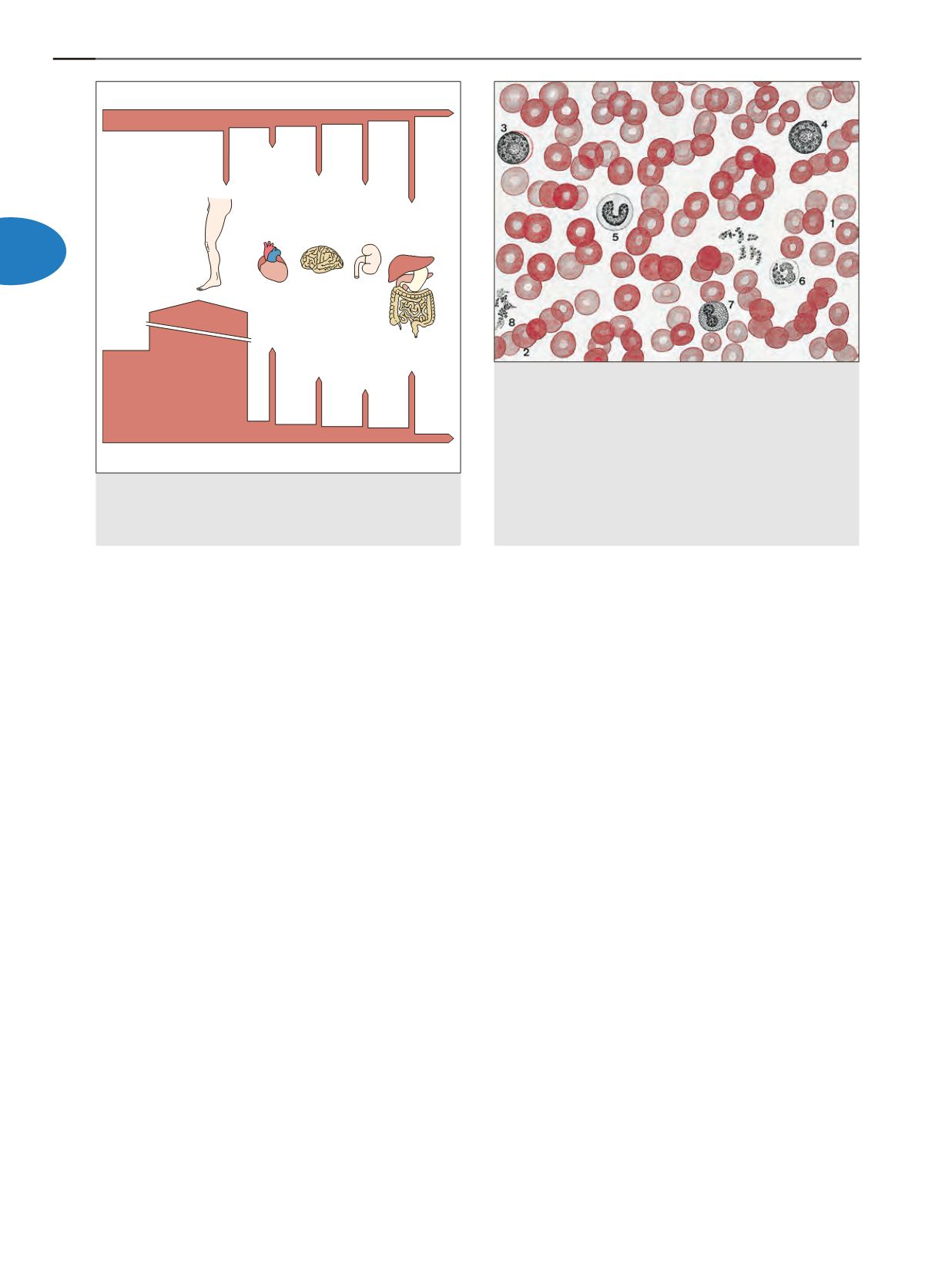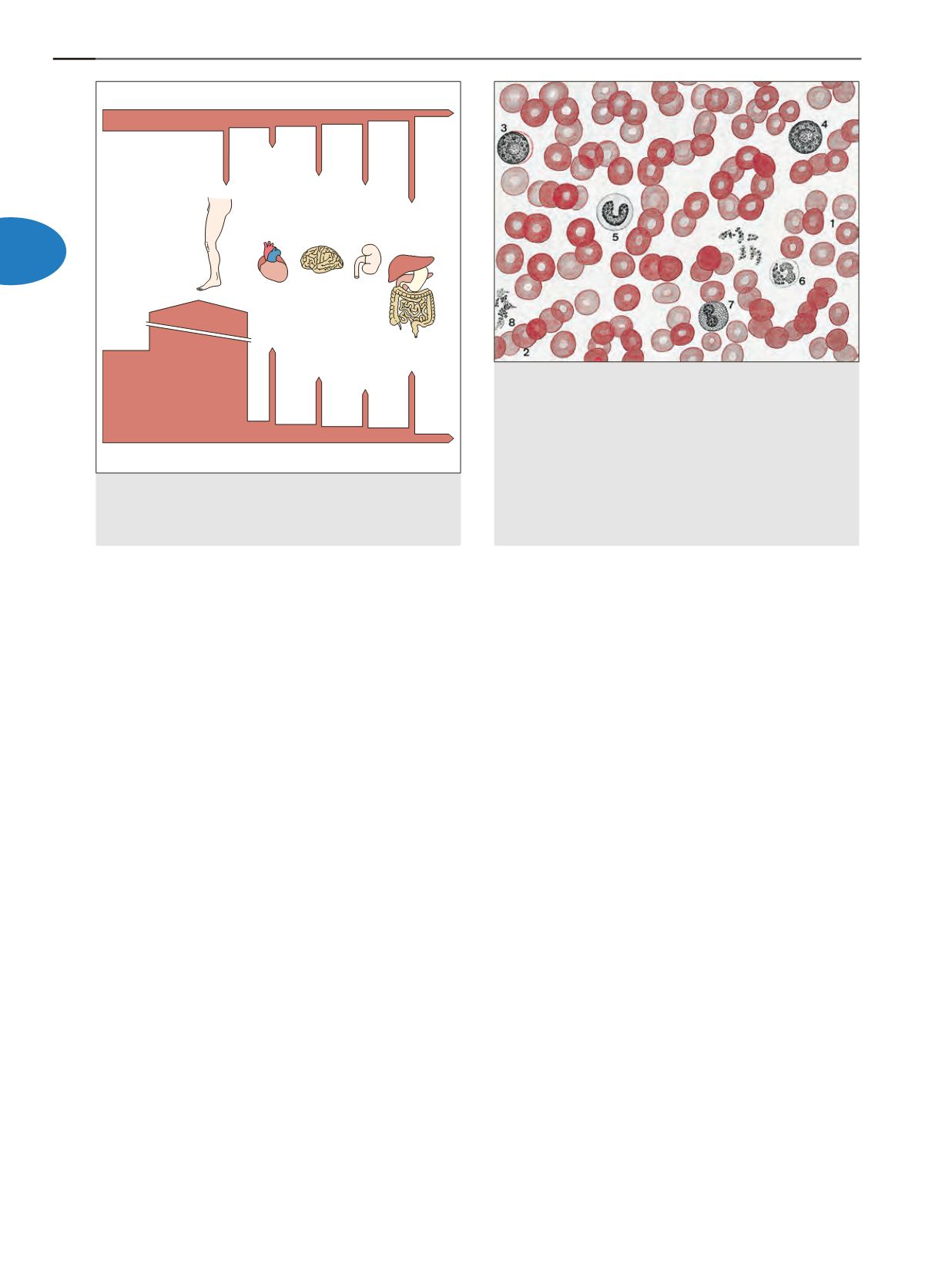
370
Das Blut
17
Wenn man einen Tropfen Blut unter dem Mikroskop
betrachtet (17.3 und schematische Abb. 17.1), dann
kann man feststellen, dass er keine einheitliche Lösung
darstellt, sondern sich aus zwei großen Anteilen, dem
Blutplasma
(flüssiger, eiweißreicher Bestandteil) und
den
Blutkörperchen
(geformte, zellige Bestandteile),
zusammensetzt.
17.1 Zelluläre Bestandteile
Bei den
Blutkörperchen
nimmt man im gefärbten Blut-
ausstrich eine Unterteilung vor in:
•• rote Blutkörperchen
(Erythrozyten),
•• weiße (besser: farblose) Blutkörperchen
(Leuko-, Lym-
pho-
und
Monozyten)
und
•• Blutplättchen
(Thrombozyten).
17.1.1 Rote Blutkörperchen
(Erythrozyten)
Die Erythrozyten (
erythrós
= rot) stellen beimMenschen
(bei normalem osmotischem Druck des Blutplasmas)
runde, bikonkave (2 µm dicke, im Durchmesser 7,5 μm
große und ein Volumen von etwa 80 µm
3
aufweisen-
de) Scheiben dar, deren Rand gegenüber dem Zentrum
dicker ist. Im Profil lassen sie eine Biskuitform erken-
nen (Abb. 17.3). Da die roten Blutkörperchen bei allen
Säugetieren – im Gegensatz zu den übrigen Wirbeltie-
ren – kernlos sind (sie verlieren während ihrer Reifung
im Knochenmark den Kern), ist ihre
Lebensdauer
be-
schränkt (120Tage), ein Abbau, der unter intensiver kör-
perlicher Belastung oder Höheneinwirkung (reduzierter
Sauerstoffpartialdruck) beschleunigt abläuft. Nach dieser
Zeit werden die älteren roten Blutkörperchen durch die
Milz und Leber aus dem Verkehr gezogen („Blutmau-
serung“) und durch neue, im roten Knochenmark der
platten Knochen (Schulterblatt, Brustbein, Hüftbein)
und Wirbelkörper gebildete Erythrozyten ersetzt.
Die
Anzahl
der roten Blutkörperchen beläuft sich beim
erwachsenen Menschen pro Liter Blut auf rund 25 Bil-
lionen, das heißt, auf 1 mm³ Blut entfallen beim Mann
5 Millionen, bei der Frau 4,6 Millionen rote Blutkör-
perchen.
Die große
Austauschfläche,
die das Blut den Stoffwech-
selvorgängen (insbesondere dem Transport von O
2
und
CO
2
) zur Verfügung stellt, wird anschaulich, wenn
man berücksichtigt, dass die aktive Gesamtoberfläche
der 25 Billionen Erythrozyten etwa 3800 m
2
ausmacht,
was annähernd dem 1750-Fachen der mittleren Kör-
peroberfläche eines Erwachsenen (1,7 m²) entspricht.
Die roten Blutkörperchen zeichnen sich durch eine
gro-
ße Plastizität
aus, so dass sie unter Veränderung ihrer
Form durch den Blutdruck durch Kapillaren gepresst
werden können, deren Lumen z.T. kleiner als der Ery-
throzytendurchmesser (s. o.) ist.
Jedes dieser Blutkörperchen setzt sich zu 63% ausWasser
und zu 37% aus einer Trockensubstanz zusammen, zu
der man in erster Linie den
roten Blutfarbstoff
(Hä-
moglobin)
und die
Gerüstsubstanz
(Stroma)
rechnet.
Diese besteht vorwiegend aus Eiweißstoffen, Cholesterin,
Lecithin und Mineralien. DemHämoglobin kommt als
physiologisch wichtigstem Bestandteil der roten Blut-
körperchen (infolge seiner chemischen Eigenschaft) die
Aufgabe des
reversiblen Transports
des in den Lun-
Abb. 17.2
Die Verteilung der Blutmenge auf den Bewegungsap-
parat und die inneren Organe im Ruhezustand und bei stärkerer
körperlicher Belastung.
in Ruhe
5 Liter/min
1,0 0,25 0,75 1,0 1,25 Liter
Muskeln
und Haut
starke
körperliche
Arbeit
25 Liter/min 21,25 1,25 0,85 0,60 0,89 Liter
Herz Gehirn Nieren Einge-
weide
Abb. 17.3
Blutausstrich (gefärbt nach May-Grünwald-Giemsa).
1 = rote Blutkörperchen
(Erythrozyten)
2 = Ketten- oder „Geldrollenform“ der
Erythrozyten
3 = großer
Lymphozyt
4 = kleiner
Lymphozyt
5 =
Monozyt
6 = gelappter (segmentierter)
neutrophiler Granulozyt
7 =
eosinophiler Granulozyt
8 = Blutplättchen
(Thrombozyten)