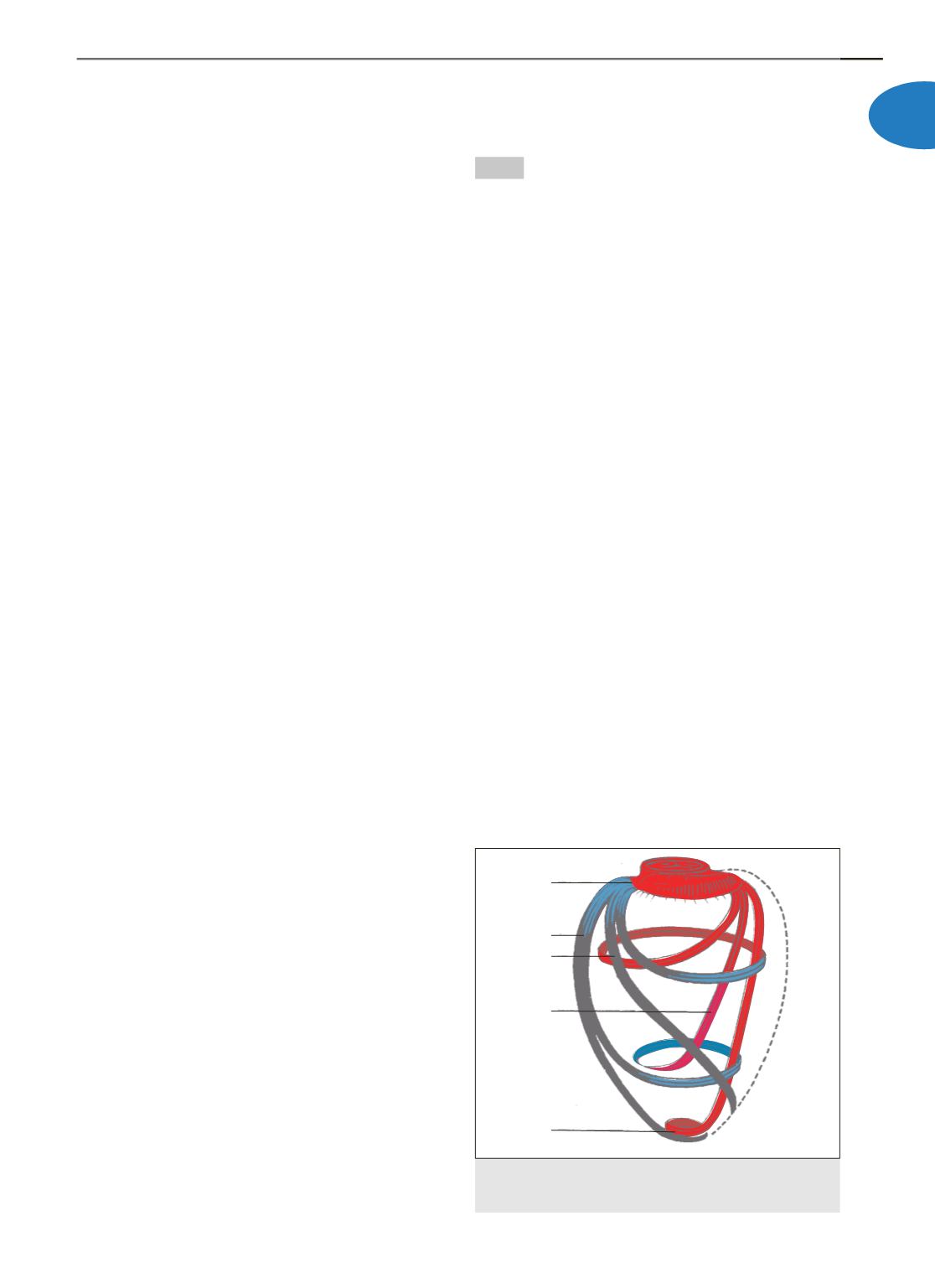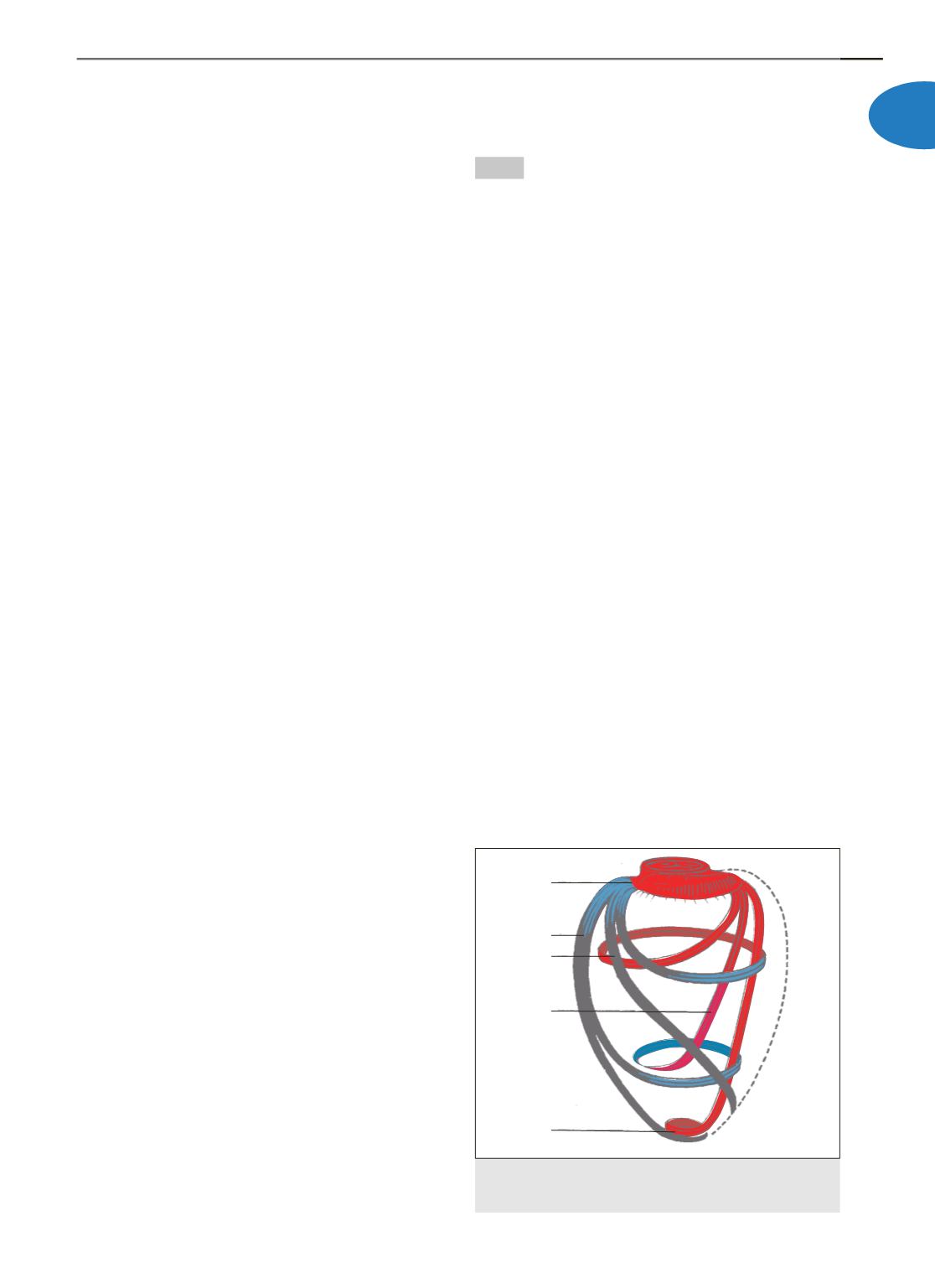
15.2 Herz und dessen Formwandel
349
15
Wir sprechen deshalb vom fetalen oder plazentaren Kreislauf, bei dem
als Besonderheit das sauerstoffreiche und -arme Blut nicht streng
voneinander geschieden sind.
Für den Blutkreislauf
ergeben sich damit Aufgaben
•• für den
Transport
(Nährstoffe wie Kohlenhydrate,
Aminosäuren, Stoffwechselendprodukte, O
2
, CO
2
,
Wasser, Hormone, Vitamine und Mineralien),
•• für den
Stoffaustausch
(durch die Kapillaren mit den
Zellen bzw. Zellverbänden),
•• für den
Wärmehaushalt
(durch die Verteilung der bei
der Muskelarbeit und bei chemischen Vorgängen in
der Leber sich entwickelnden Wärme und deren Ab-
gabe aus demKörperinnern an die Körperoberfläche),
•• für die
Sicherung einer stabilen Lage der Arterien
durch den arteriellen Blutdruck,
•• für die
Auffüllung der Schwellkörper
durch Blut-
stauung und
•• für die
Abwehr von Schadstoffen
durch Phagozyten
und Antikörper, wodurch die Integrität der Lebens-
prozesse gesichert wird (
▶
Immunsystem, 18.4).
15.2 Herz und dessen Formwandel
Gewebeschichten des Herzens
Das sich der Brustwand anschmiegende und etwas nach
links verlagerte Herz
(Cor)
– Anfang und Ende des Blut-
umlaufs – stellt ein abgestumpftes kegelförmiges Hohl-
organ dar, das von
3 Schichten
aufgebaut wird:
•• dem zarten, die Innenräume des Herzens (einschließ-
lich der Klappen, s. u.) auskleidenden
Endokard,
das – aus einem Endothel und einer kontinuierlichen
Basalmembran bestehend – die inneren Oberflächen,
an denen das Blut vorbeigleitet, glättet. Auf Grund
der größeren Druckbeanspruchung, ist es im Bereich
der linken Herzhälfte kräftiger als rechts entwickelt.
Endokardiale Bildungen (ausgefaltete Duplikaturen)
sind z. B. die Herzklappen, die sich aus einer festen
Bindegewebsgrundmembran mit allseitigem Endo-
thelüberzug aufbauen.
•• der eigentlichen Herzmuskulatur, auch
Myokard
genannt (s. u.) und
•• der serösen Umhüllung, dem
Epikard,
das – von
Fett- und Bindegewebe unterfüttert, um Uneben-
heiten an der Herzoberfläche auszugleichen und die
Herzkranzgefäße einzubetten – fest mit der Oberflä-
che des Herzens verwachsen ist.
Im Bereich der Aorta und der Lungenschlagader
schlägt sich das Epikard in das fibröse
Perikard
um,
in das unser Herz mit dem Anfangsteil der großen
Blutgefäße als Ganzes hineingestülpt ist, wobei zwi-
schen Epi- und Perikard ein schmaler, mit etwas
klarer, eiweißhaltiger Flüssigkeit (normalerweise:
10 cm
3
) benetzter Spalt übrig bleibt, der die Funkti-
on einer Verschiebeschicht oder Gleitschicht ausübt.
Die Perikardschicht, die sich mit ihren kollagenen,
überkreuzenden Fasern einer Überdehnung des Her-
zens widersetzt, bildet mit der Epikardschicht den
Herzbeutel
.
K
linik
Kommt es zu einer Entzündung des Herzbeutels
(Perikardi-
tis)
, dann ergeben die rau gewordenen Wände bei jeder Kontraktion
des Herzens ein Reibegeräusch (trockene Herzbeutelentzündung), wie
wir es auch von einer gleichartigen Erkrankung des Rippenfells oder
der Sehnenscheiden kennen. Sondert die entzündete seröse Haut des
Herzbeutels vermehrt Flüssigkeit ab, so entsteht eine Verbreiterung des
kapillaren Spalts zwischen Epi- und Perikard (Herzbeutel-Wassersucht),
wodurch das Herz in seiner Tätigkeit nicht unwesentlich behindert wird.
Von allen drei Schichten des Herzens erfordert die mitt-
lere, das
Myokard,
unser besonderes Interesse. Es weist
– rein makroskopisch – speziell an der linken Kammer
ein am „Herzskelett“ (s. u.) beginnendes und endendes
dreischichtiges skelettmuskulöses Raumwerk
auf, das
aus
•• äußeren Schräg-,
•• mittleren Ringfasern und
•• inneren Längsfasern besteht (Abb. 15.2).
An der dünnwandigen Herzspitze
(Apex cordis)
bie-
gen die linksgerichteten äußeren, schraubenförmigen
Schrägfasern in die rechtsgerichteten inneren Längszüge
in Form eines Wirbels
(Vortex cordis)
um, wodurch ein
von lockeremBindegewebe durchsetztes, sehr gut kapilla-
risiertes, überdurchschnittlich hypoxiefestes, zusammen-
hängendes Maschenwerk entsteht, das bei Kontraktion
der Fasern den Kammern eine kräftige Auspressung des
Blutes ermöglicht.
Im Bereich der Vorhöfe gibt es nur eine sehr dünne,
aus äußeren, queren und inneren, bogenförmigen Fa-
serzügen bestehende Muskulatur. Bereits dieser spezi-
fische funktionell-strukturelle Aufbau der Vorhof- und
Kammermuskulatur deutet den recht unterschiedlichen
Arbeits- und Kraftaufwand der beiden Herzabschnitte
für die Fortbewegung des Blutes an. Von den Ventrikeln
Abb. 15.2
Schematische Darstellung des Muskelfasersystems
im Bereich der linken Herzkammer.
1
2
3
4
5