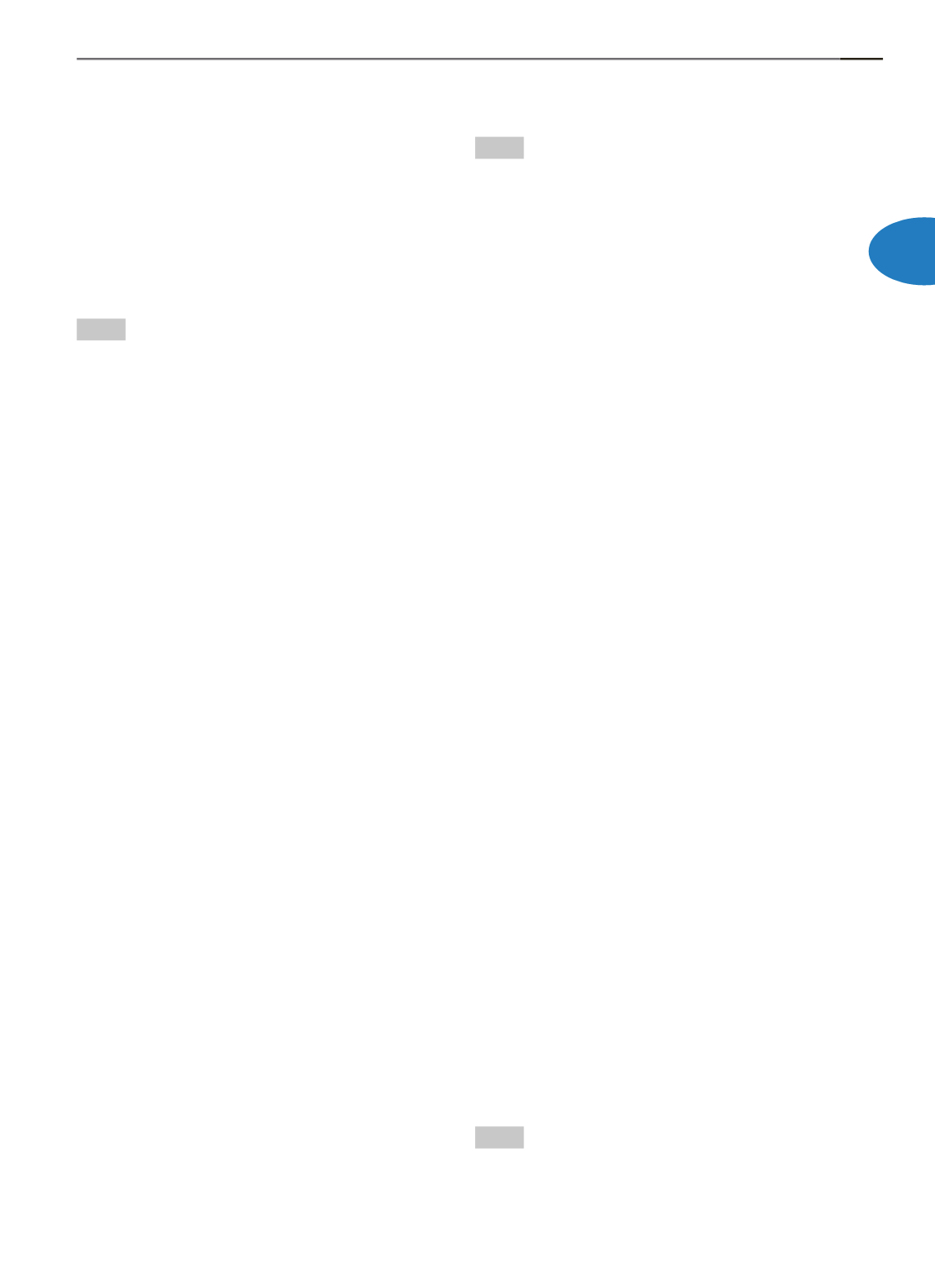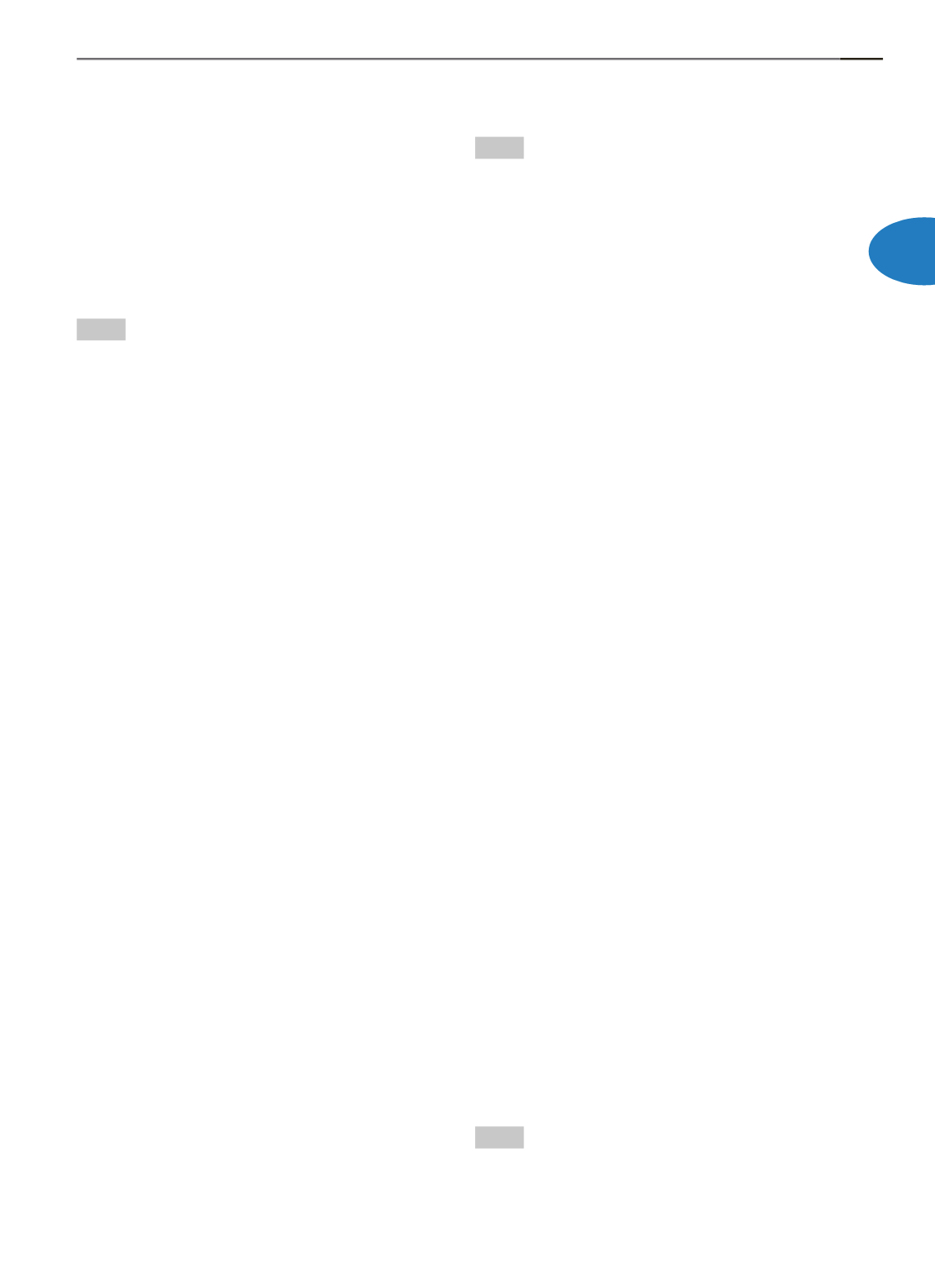
17.1 Zelluläre Bestandteile
371
17
gen aufgenommenen Sauerstoffs zu den Geweben und
von Kohlendioxid aus den Geweben zur Lunge zu. Auf
Grund ihres hohen Gehalts an
Oxyhämoglobin
verlei-
hen die Erythrozyten dem arteriellen Blut eine hellrote,
durch das reduzierte Hämoglobin dem venösen Blut
eine dunkelrote Farbe.
Das Hämoglobin ist eine Komplexverbindung von Ei-
weiß
(Globin)
und einem eisenhaltigen Farbstoff
(Häm-
ochromogen).
Die Hämoglobinkonzentration beläuft sich
normalerweise beimMann auf 135–175 g/l Blut, bei der
Frau im gebärfähigen Alter auf 125–150 g/l Blut.
S
port
Interessant ist, dass durch einmehrwöchiges Ausdauertrai-
ning in einer Höhe von mindestens 1800 m – also unter Sauerstoff-
mangelbedingungen
(Hypoxie)
– eine deutliche Vermehrung der roten
Blutkörperchen und damit des Hämoglobins imBlut zu beobachten ist
(s. u.). Es kommt zu einer Verschiebung der Sauerstoffbindungskurve
mit Verbesserung der Transportkapazität.
17.1.2 Farblose Blutkörperchen
(Leukozyten)
Die kugeligen,
kernhaltigen,
farblosen Blutkörperchen
(ihr Durchmesser schwankt zwischen 7 µm
[Lympho-
zyten]
und 20 µm
[Monozyten]
) sind in der Blutbahn
unseres Organismus in einer wesentlich
geringeren An-
zahl
vertreten als die Erythrozyten. Beim Erwachsenen
entfallen auf 1 mm³ Blut 6000–8000 Leukozyten (beim
Kind nur 1800). Somit kommt auf 700 rote Blutkörper-
chen jeweils 1 farbloses.
ImGegensatz zu ersteren ist die Zahl der farblosen Blut-
körperchen oft beträchtlichen Schwankungen unterwor-
fen. Das Lebensalter, der jeweilige Gesundheitszustand
und vor allem große körperliche Anstrengungen rufen
eine deutliche Verschiebung des Verhältnisses der ein-
zelnen Leukozytengruppen hervor. Ihre Lebensdauer
beläuft sich nur auf 3–5 Tage.
Infolge ihrer unterschiedlichen Form und Anfärbbarkeit
unterscheidet man im Blutbild
verschiedene
Leuko-
zytenarten:
Granulozyten, Lymphozyten
und
Mono-
zyten.
Granulozyten
Die Granulozyten sind so genannt, weil sie intrapro-
toplasmatische Körnchen –
Granula
– aufweisen. Sie
stellen beim Erwachsenen den Hauptanteil des weißen
Blutbilds (65–75%) dar. Sie sind kernhaltig und zeich-
nen sich durch amöboide Bewegungen aus (Abb. 17.3).
Dadurch sind die 10–14 μm großen Granulozyten in
der Lage, aktiv aus der Blutbahn durch 3 μm große Po-
ren der dünnen Gefäßwand auszutreten (ein Vorgang,
den wir als
„Diapedese“
bezeichnen) und in das Gewebe
einzudringen, was ihnen die Bezeichnung „Wanderzel-
len“ eingebracht hat. Des Weiteren kommt ihnen die
Aufgabe zu, den Kampf mit eingedrungenenMikroorga-
nismen (Krankheitserregern) aufzunehmen („Polizisten“,
„Straßenfeger“, „Samariter des Zellenstaates“) und diese
„aufzufressen“, da sie körpereigene Gewebe verdauende
(proteolytische) Fermente produzieren. Man nennt sie
deshalb auch „Fresszellen“
(Phagozyten).
E
xkurs
Eiter ist in erster Linie eine Zusammenballung von neutro-
philen Granulozyten, die im Abwehrkampf gegen die eingedrungenen
Bakterien zugrunde gegangen sind.
Die Granulozyten werden im roten Knochenmark gebil-
det und lassen sich nach ihrer Kerngestalt in mononukle-
äre und polymorphkernige, nach ihrer unterschiedlichen
Färbbarkeit mit spezifischen Farbstoffen in
•• feinkörnige
neutrophile
Zellen (sie bildenmit 60–70%
bei Weitem die Mehrzahl aller Granulozyten) und
•• grobkörnige
eosinophile
und
basophile
(sie werden nur
in 2–4% im Blut angetroffen) Zellen einteilen.
Die Kerne der neutrophilen Granulozyten weisen in
etwa 3% beim weiblichen Geschlecht geschlechtsspe-
zifische Formunterschiede auf, die durch das sog.
Sex-
chromatin
entstehen. So lassen die neutrophilen Zellen
einen kleinen, gestielten Kernanhang
(„drumstick“
=
Trommelschlägel) oder dem Kern aufsitzende sog. Barr-
Körperchen erkennen. Beide sind mit einem der zwei
X-Chromosomen des weiblichen Geschlechts identisch.
Lymphozyten
Die Lymphozyten entstehen zum Teil im Thymus („T-
Lymphozyten“), zum Teil im Knochenmark („B-Lym-
phozyten“) und siedeln sich im Bereich der Primär- und
Sekundärfollikel aller lymphatischen Gewebe an (nur
2% aller Lymphozyten zirkulieren im Blut). Sie machen
beim Erwachsenen etwa 35–40%, beim Kleinkind 40–
50% und beim Neugeborenen 50–60% aller farblosen
Blutkörperchen aus. Ihre Gesamtzahl wird weitgehend
vom Lebensalter bestimmt.
Die im Querschnitte 10–15 μm messenden Lympho-
zyten weisen einen verhältnismäßig großen runden bis
ovalen Kern ohne gekörntes Protoplasma auf, weshalb sie
auch als
Agranulozyten
bezeichnet werden (Abb. 17.3).
Sie befinden sich ständig auf Wanderschaft, indem sie
nach Ausschwemmung aus dem lymphatischen Gewebe
über die Lymphbahnen ins Blut gelangen, um über die
postkapillären Venulen schließlich wieder in das lympha-
tische Gewebe zurückzukehren. Die Lymphozyten haben
somit die Möglichkeit, den Organismus ständig nach
körperfremden Substanzen abzutasten, Gegenreaktionen
(Antikörperbildung) auszulösen und ihre Verantwortung
für die humorale und Zellimmunität (bei Infekten mit
grampositiven Bakterien bzw. mit Pilzen und Viren)
wahrzunehmen. Sie gehen entweder in Erfüllung ihrer
Funktion oder durch Auswanderung in die Lichtung von
Schleimbeuteln oder durch Transformation in Plasma-
zellen zugrunde.
E
xkurs
Interessant ist, dass ein Teil der Lymphozyten in Lympho-
blasten umgebildet werden kann, die wieder ihrerseits Lymphozyten
entstehen lassen, so dass ein bestimmter Prozentsatz der Lymphozyten
im Prinzip „unsterblich“ ist.