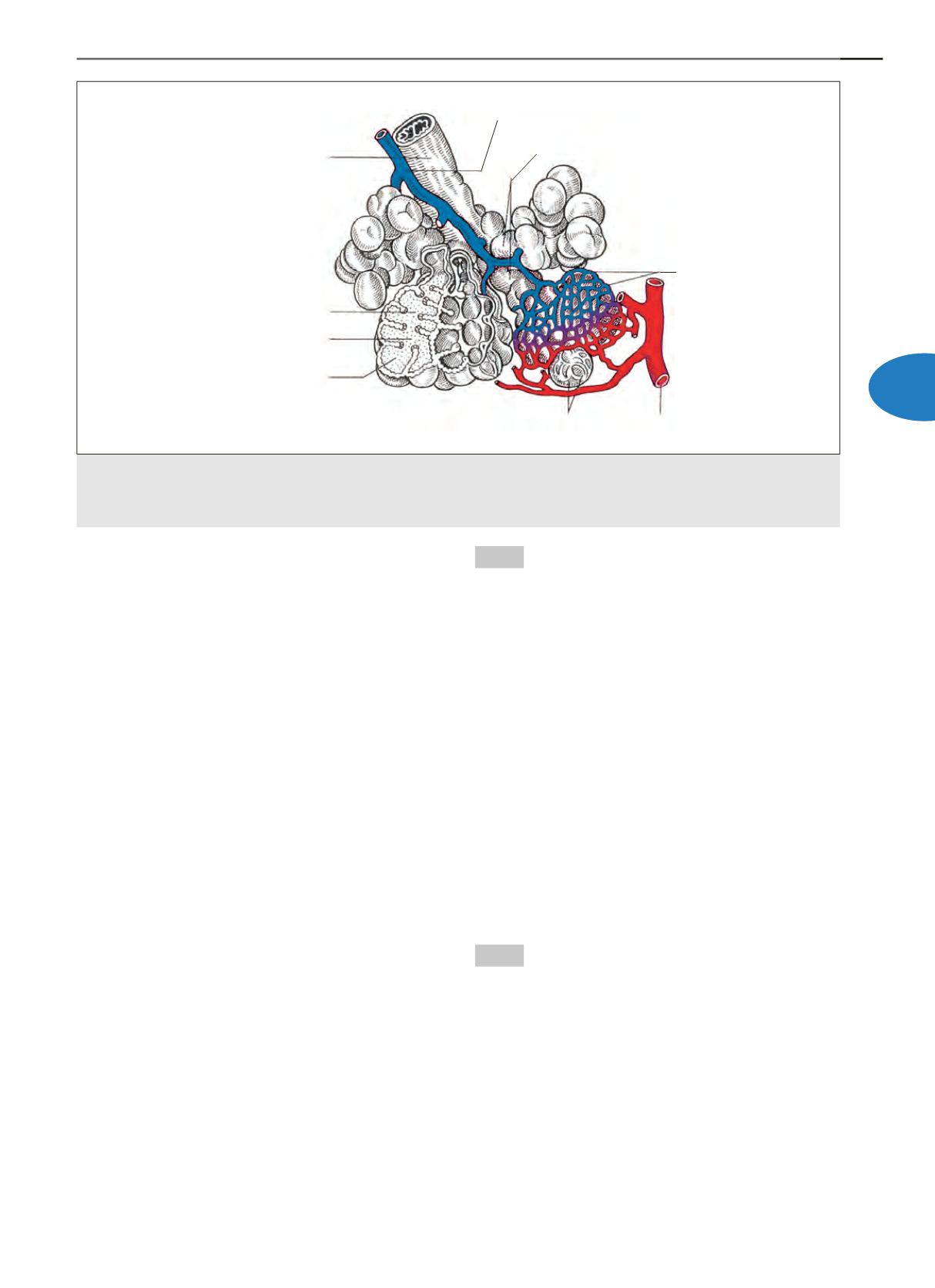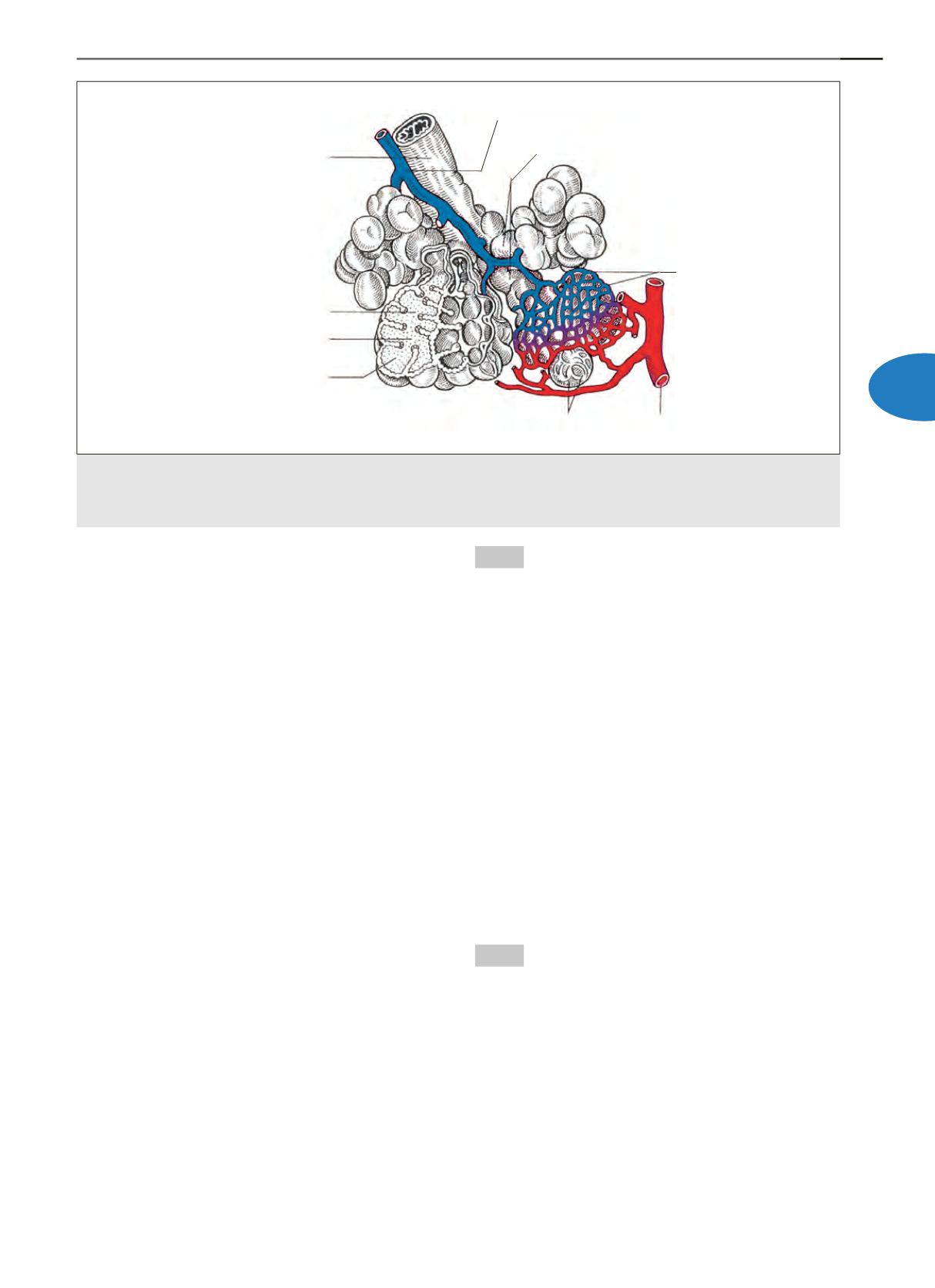
19.3 Innere Atmung
383
19
Während untrainierte erwachsene Männer mit etwa 3 l O
2
-Aufnahme/
min die Grenze ihrer allgemeinen aeroben Leistungsfähigkeit errei-
chen (was eine Diffusionskapazität von 40ml/min/mmHg voraussetzt),
zeichnen sich ausdauertrainierte Sportler
,
die eine Ergometerleistung
von über 400 Watt erreichen, durch eine maximale O
2
-Aufnahme von
5–6 l/min aus (was eine Diffusionskapazität von 70 bzw. 85 ml/min/
mmHg bedingt). Die Grenzen der aeroben Leistungsfähigkeit sind
deshalb nicht in denMuskelfasern, sondern im respiratorischen System
– von der Lunge bis zu denMitochondrien der Muskulatur – zu suchen.
Im Alveolargebiet, das kein Flimmerepithel be-
sitzt, erfolgen die Aufnahme und der Abtransport
der Staubpartikelchen durch die
Alveolarphagozy-
ten
(„Fresszellen“). Somit kommt den Lungenbläs-
chen neben ihrer Hauptfunktion noch eine gewisse
Schutzfunktion zu.
Die beiden Lungen stecken in einer serösen Haut, die
auch
Pleura
genannt wird. Sie ist unterteilt in zwei
Blätter,
•• von denen das innere der Oberfläche der Lungen
unmittelbar aufliegt und auch in die Lappenspalten
hineinzieht („Lungenfell“
= Pleura pulmonalis
),
•• während das äußere Blatt die Innenfläche des Brust-
korbs auskleidet („Brustfell“
= Pleura parietalis
) und
auch die zwischen den beiden Lungen gelegenen Or-
gane sowie das Zwerchfell überzieht.
Der den Rippen aufliegendeTeil des Brustfells wird „Rip-
penfell“
(Pleura costalis)
genannt, eine Bezeichnung, die
sich im klinischen Sprachgebrauch auf das ganze Brustfell
erstreckt.
K
linik
Der zwischen beiden Pleurablättern vorhandene kapillare
Spalt wird normalerweise von einem feinen Flüssigkeitsfilm benetzt,
so dass die auf ihrer Oberfläche nunmehr schlüpfrigen Blätter bei der
Brustkorbformänderung beim Atmen ohne Reibung aneinander vor-
beigleiten können. Erkrankt das Rippenfell, dann kommt es entweder
zu einer Vermehrung der Flüssigkeit (
feuchte
Rippenfellentzündung =
Pleuritis exsudativa
) oder zu einer Reduzierung derselben (
trockene
Rippenfellentzündung =
Pleuritis sicca
), ein Zustand, der mit heftigen
Schmerzen verbunden ist, da die sehr nervenreichen Pleurablätter bei
der Ein- und Ausatmung sich nun aneinander reiben, was vomArzt wäh-
rend des Abhorchens der Lunge (Auskultation) deutlich in Form eines
knarrenden Geräuschs („Lederknarren“) diagnostiziert werden kann.
Im kapillaren Spalt besteht ständig ein
Unterdruck
,
der dafür Sorge trägt, dass die Lunge sich während des
gesamten Lebens in einem passiv gedehnten Zustand
befindet (der bei tiefster Inspiration 30 Torr, bei stärkster
Exspiration 3–4 Torr beträgt). Auf Grund der Adhäsi-
onswirkung des Flüssigkeitsspaltes müssen die Lungen
allen Exkursionen des Brustkorbs passiv folgen.
K
linik
Bringt der Arzt von außen eine gewisse Luftmenge in den
Pleuraspalt, wie es bei der künstlichen Anlegung eines Pneumotho-
rax
geschieht, oder dringt bei einer Brustkorbverletzung Luft in den
Plauraspalt, dann fällt die jeweilige Lunge auf Grund ihrer Elastizität
weitgehend in sich zusammen, da die Adhäsionswirkung des Flüssig-
keitsspalts beseitigt worden ist.
Abb. 19.7
Halbschematische Darstellung des respiratorischen Kapillarnetzes im Bereich einiger Lungenbläschen. Zur Veranschauli-
chung kommen außerdem das elastische Fasergerüst zweier Alveolen sowie an einem aufgeschnittenen Lungenbläschengang mehrere
Lungenbläschenscheidewände.
kleiner Luftröhrenzweig
(Bronchiolus terminalis)
Atmungszweig
(Bronchiolus alveolaris)
Lungenbläschengang
(Ductus alveolaris)
Lungenbläschensäckchen
(Sacculus alveolaris)
Lungenbläschen
(Alveole)
Ast der Lungenschlagader
Ast der Lungenblutader
Kapillar-
netz
elastischer Faserkorb einer Alveole